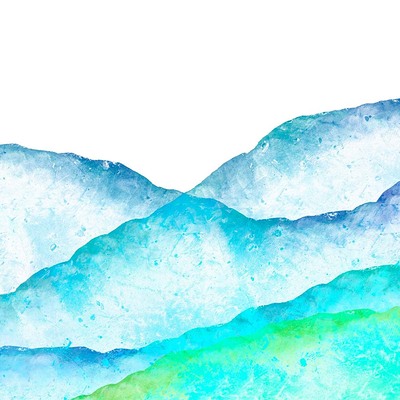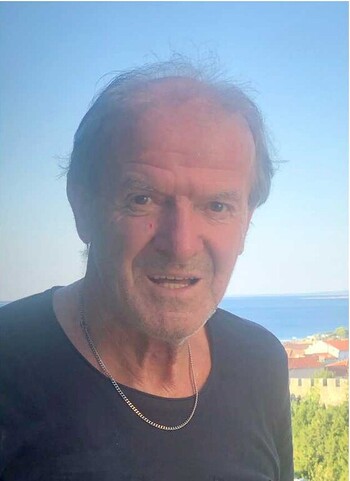Sa 20.4.24
Öffnungszeiten Pfarrbüro
Mo
08:00 - 10:00
Mi
08:00 - 12:00
Fr
08:00 - 12:00