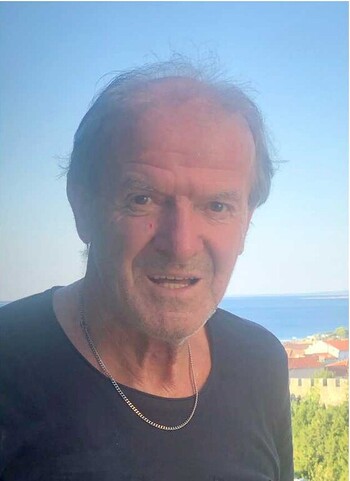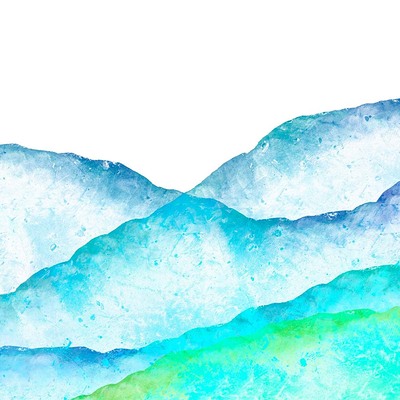Joh 6, 52-59
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
In jener Zeit
52 stritten sich die Juden und sagten: Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben?
53 Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, das sage ich euch: Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch.
54 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag.
55 Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise, und mein Blut ist wirklich ein Trank.
56 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm.
57 Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben.
58 Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen haben; sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit.
59 Diese Worte sprach Jesus, als er in der Synagoge von Kafarnaum lehrte.
Lesung aus der Apostelgeschichte
In jenen Tagen
1 wütete Saulus immer noch mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohenpriester
2 und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, die er dort finde, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen.
3 Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte.
4 Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich?
5 Er antwortete: Wer bist du, Herr? Dieser sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst.
6 Steh auf und geh in die Stadt; dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst.
7 Seine Begleiter standen sprachlos da; sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand.
8 Saulus erhob sich vom Boden. Als er aber die Augen öffnete, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein.
9 Und er war drei Tage blind, und er aß nicht und trank nicht.
10 In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias! Er antwortete: Hier bin ich, Herr.
11 Der Herr sagte zu ihm: Steh auf und geh zur so genannten Geraden Straße, und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus. Er betet gerade
12 und hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sieht.
13 Hananias antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat.
14 Auch hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen.
15 Der Herr aber sprach zu ihm: Geh nur! Denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug: Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen.
16 Ich werde ihm auch zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss.
17 Da ging Hananias hin und trat in das Haus ein; er legte Saulus die Hände auf und sagte: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist; du sollst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden.
18 Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er sah wieder; er stand auf und ließ sich taufen.
19 Und nachdem er etwas gegessen hatte, kam er wieder zu Kräften. Einige Tage blieb er bei den Jüngern in Damaskus;
20 und sogleich verkündete er Jesus in den Synagogen und sagte: Er ist der Sohn Gottes.
Weiterführende Links: